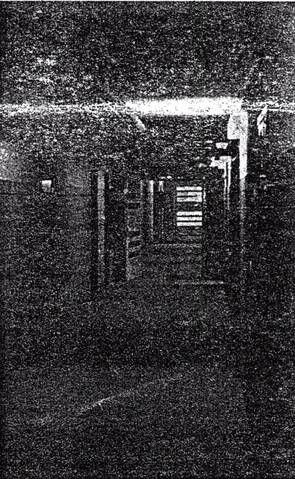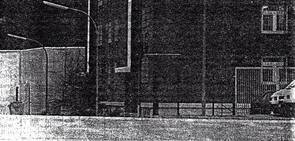20.01.1995
Schweigen im Walde
Versteckt im Stöckerbuscher Forst, einem unzugänglichen Walggebiet in Westfalen, liegt der größte Abschiebeknast der BRD. Wer hier landet, ist verloren. Er kann gefoltert und mit Psychopharmaka vollgestopft werden, ohne dass jemand danach fragt.
Von Gaby Hommel
Menschen aus dem Ruhrgebiet schätzen die vergleichsweise unberührte Natur im dünnbesiedelten Herzen von Westfalen. Geschützte Talsperren, schmucke Dörfer und Bauernhöfe locken zur Naherholung. Das Kleinstädtchen Büren, 20 Kilometer von Paderborn entfernt, gehört nicht gerade zu den beliebtesten Ausflugszielen. Der Stöckerbuscher Forst dagegen, ein ausgedehntes Wald- und Wandergebiet 8 Kilometer außerhalb des langweiligen Provinznestes gelegen, ist durchaus einen Ausflug wert. Dort nämlich erwartet SpaziergängerInnen ein Erlebnis, wenn plötzlich, fernab von der nächsten Landstraße, eine eindrucksvolle Betonfestung zwischen den Nadelhölzern auftaucht. Ihre Mauern, 6 Meter hoch, 700 Meter lang und mit Stacheldraht bewehrt, erlauben keinen neugierigen Blick ins Innere. Videokameras und scharfe Hunde verraten jeden, der sich zu nähern wagt.
Früher galt das Hunderte von Quadratmetern große Gelände als militärisches Sperrgebiet. Belgische Soldaten und – so wird im benachbarten Büren gemunkelt - Cruise Missiles waren hier stationiert. Ende 1993 wurde das geheimnisumwitterte Areal umgebaut. Seit Februar 1994 dient es als Vorzeigeknast der Düsseldorfer Landesregierung. Rund 500 Männer werden dort zurzeit gefangen gehalten. Die Glücklicheren von ihnen sind illegale Bauarbeiter aus Polen, die innerhalb weniger Tage in ihr Herkunftsland zurücktransportiert werden. Die anderen kommen aus Afrika und Asien. Sie sitzen Monate und Monate hinter Gittern, werden weder als Flüchtlinge anerkannt noch freigelassen, um sich woanders einen Platz zum Leben zu suchen.
Ist man fremd in Büren und spricht die Leute auf der Straße an, so stellen sich die Befragten unwissend. Niemand will sagen können, worin die genaue Funktion des Gefängnisses im Walde besteht. Allgemein ist von „ausländischen Kriminellen“ die Rede. Und wer es sich besonders leicht machen will, streitet gar ab, jemals von dem Abschiebeknast vor der Haustür gehört zu haben. Dabei gibt es in der verschlafenen Kleinstadt kaum ein Familienfest und kaum eine Stammtischrunde, die „den Stöckerbusch“ – wie es im Lokaljargon heißt – nicht zum Thema hat.
Mit der geschickt lancierten Nachricht, Büren sei als Standort für ein Flüchtlingssammellager vorgesehen, fingen die Aufregung an. Geschäftsleute und Vorgärtenbesitzer sahen sich bereits von bettelnden und klauenden Ausländern umbringt, als im Sommer 1993 die Entwarnung kam. Das Düsseldorfer Innenministerium, so hieß es, habe umdisponiert und beschlossen, die ehemalige Kaserne im Stöckerbusch zu einer Abschiebehaftanstalt zu machen. „Wir haben sicherlich den besseren Teil erwischt“, brachte Stadtdirektor Wolfgang Runge die ehemalige Erleichterung von Verwaltung, BürgerInnen und Lokalpresse auf den Punkt. „Eine geschlossene Anstalt bringt mehr Sicherheit für die Bevölkerung als ein offenes Sammellager.“
Doch nur kurz währte die wiedergewonnene Ruhe der Bürener. Bereits im Herbst des gleichen Jahres tauchte ein neues Schreckgespenst auf. Diesmal deutschen Blutes, aber in Gestalt gewaltbereiter Autonomer nicht minder gefürchtet als die in letzter Minute hinter Gittern gebändigten Ausländer. Unter der Schlagzeile „Größte Abschiebehaftanstalt zieht ´Szene´ verstärkt an“ machte die Ortszeitung auf das Problem aufmerksam. „Wandschmierereien mit politischen Parolen und Flugblattaktion“ im erzkonservativen Landkreis Paderborn in der Tat eine recht seltene Beobachtung, lieferten den entsprechenden Beweis.
Endgültig in Sorgenfalten legten sich die Gesichter der braven Bürger und Bürgerinnen von Büren, als im Mai letzten Jahres knapp 500 Menschen durch den Ortskern zum Knast zogen. Zwar wurde die Demonstration von Panzerwagen und schwarz maskierten Sondereinheiten der Polizei in Schach gehalten. Was aber, so fragen sich die in ihren Häusern verbarrikadierten AnwohnerInnen, würde passieren, wenn die Chaoten in Zukunft auf andere Art protestieren und – kaum auszudenken! - die Ausländer aus ihrem Gefängnis ausbrechen würden?
Fragen dieser Art wurden von der Stadtspitze dankbar aufgegriffen, in der Kreisverwaltung Paderborn diskutiert und auf Landesebene souverän gelöst. Augenfälliger Beweis ist die permanente Stationierung einer polizeilichen Eingreiftruppe im Nachbardorf von Büren. Sie dient der Gefangenenabwehr nach innen und außen und wird wirksam unterstützt vom bewaffneten Rambos der Privatfirma „Security Service Kötter“ aus Essen, die zwei Drittel des Knastpersonals in Büren stellen und, im Unterschied zu ihren beamteten Kollegen, weder durch disziplinarischrechtliche Verfahren kontrolliert noch durch eingeschränkte Gesetzesbestimmungen am Schusswaffengebrauch gehindert werden können.
Möglich wird der Einsatz von sogenannten „Schwarzen Sheriffs“ in Büren und anderen Flüchtlingsknästen durch den Umstand, dass es für den Vollzug von Abschiebehaft keinerlei gesetzliche Grundlage gibt. Das Ausländerrecht erlaubt zwar die Inhaftierung, sagt aber nichts über die Bedingungen der Haft und die Rechte von Abschiebegefangenen aus. Normalerweise werden derartige Probleme über die Justizvollzugsordnung geregelt. Deren Vorschriften greifen im Fall von Abschiebeknästen aber nur bedingt, da diese keine Justizvollzugsanstalten im eigentlichen Sinne sind. Sie stehen vielmehr unter Verantwortung der jeweiligen Landesinnenministerien und werden lediglich in Amtshilfe von den Justizbehörden geführt. Weshalb die Container ehemaligen Kasernen und sonstigen ausgedienten Gebäude, in denen Flüchtlinge und MigrantInnen gefangen gehalten werden, im offiziellen Sprachgebrauch auch nicht „JVA“ heißen, sondern mit Sprachschöpfungen wie „Hafthaus“ oder „Gewahrsamseinrichtung“ belegt werden.
Der Abschiebeknast in Büren ist in jeder der genannten Hinsichten federführend. Nicht zufällig wird er von offizieller Seite als Modellprojekt betrieben. Sein ausgeklügeltes System von Strafmaßnahmen, mit dem jeder Ansatz von Widerstand im Keim erstickt wird, ist ein Grund dafür. Mit vergleichsweise harmlosen Maßnahmen wie Streichung des Hofgangs, Besuchsverbot, Essensentzug und ein paar Schlägen fängt es an. Wer dann noch auf aufmuckt kommt in Einzelhaft oder eine besondere Arrestzelle, in der es nichts außer einer fest verankerten Pritsche gibt. Schließlich gibt es für renitente Fälle die Institution der „besonders gesicherten Haft“. Dazu wird der Häftling von einem Rollkommando entkleidet und nackt in einem video-überwachten Kellerraum gesteckt, der neben einem Loch zum Schießen und eine Neonröhre nur noch eine reiß- und brandfeste Matratze enthält.
Direkt verantwortlich für diese und andere Misshandlungen ist Bürens Knastchef Peter Möller, ein Ehrgeizling und Zyniker, der stolz auf seine gute Arbeit ist und dies auch ungeniert kundtut. Anders als seine Schließer, die bereits zu Beginn des Jahres 1994 über ihre Personalräte an die Öffentlichkeit gingen und den Abschiebeknast im Stöckerbuscher Wald als „Hexenkessel“ bezeichneten, sieht er keinen Grund für Kritik: In kaum zu überbietender Selbstsicherheit leugnet er nicht einmal die in seinem Haus übliche „Schaukelfesselung“, bei der Hände und Füße gebunden und zusätzlich auf den Rücken zusammengeschlossen werden, sodass der Gequälte gezwungen ist, den Körper in embryonaler Haltung zu verbiegen.
Im Gegenteil: Der gelernte Jurist stellt diese – international als Folter geächtete und in deutschen Gefängnissen verbotene – spezielle Art der Fixierung als „Maßnahme im Interesse der Betroffenen“ dar, um die einige Flüchtlinge sogar ausdrücklich bitten würden. Schützenhilfe leisten ihm bei derart absurden Aussagen seine Vorgesetzten bis hin zu Nordrhein-Westfalens Justizminister Krumsiek, der die Selbstmorde, Selbstverstümmelungen und sonstigen Verzweiflungstaten in bundesdeutschen Abschiebeknästen als folkloristische Eigenart bewertet. Wörtlich meint er „Selbstbeschädigungen (!!!) sind gerade bei Gefangenen aus dem außereuropäischen Kulturkreis nicht selten. In der Regel haben sie lediglich demonstrativen Charakter.“
Mitglieder des Bürener Vereins „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ erhoben Strafanzeige gegen Anstaltsleiter Möller. Auslöser waren Zeichnungen und der geradebrechte Satz „Danach ich gehen wie Roboter“, mit denen ein Abschiebehäftling den ehrenamtlichen GefangenenbetreuerInnen deutlich zu machen suchte, was ihm in dem – nach einer ersten Revolte von algerischen Flüchtlinge im April 1994 – systematisch ruhiggestellten Vorzeitknast passiert war.
Damals waren in der Nacht Helikopter auf dem Gelände gelandet. Die Gefangenen wurden aus den Betten geprügelt und mussten sich im Gefängnishof aufstellen. Was danach geschah, behalten die Herren vom Stöckerbuscher Wald für sich. Fest steht nur, dass die couragierten Anführer des Aufstandes verschwanden und in den Folgetagen weder BesucherInnen noch BetreuerInnen oder AnwähltInnen das Gefängnis betreten durften.
Seitdem herrscht Schweigen im Walde. Immer mehr Gefangene sind erschöpft von ergebnislosen Widerstandsversuchen, abgemagert von dem ungenießbaren Fraß der Catering-Firma „Ecü-Menü GmbH“ und vollgepumpt mit Medikamenten, die der in Bürens Kneipen prahlende Knastsanitäter den Gefangenen jeden Tag verabreicht.
„Hilfe für Menschen in Abschiebehaft e.V.“, PF1451 Büren, 33133 Büren, Spendenkonto: Sparkasse Büren, BLZ: 47250101, KNR: 50001593